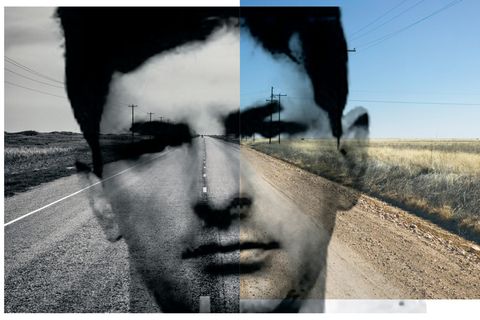Herr Harbort, warum haben Sie ein Buch über Serienmörder geschrieben?
Ein Fall, mit dem ich als Kriminalpolizist 1991 zu tun hatte, brachte mich auf dieses Thema: Ein 25-jähriger Mann erstatte damals Vermisstenanzeige. Sein Stiefvater sei seit Tagen verschwunden. In der Vernehmung des Mannes ergaben sich aber viele Widersprüche. Es kam letztlich heraus, dass er hintereinander mit einem Mittäter seinen Stiefvater, seine Stiefschwester und seine Ex-Freundin ermordet hatte. Der Grund: man wollte "forciert erben". Mich hat damals die vollkommen unangebrachte Sachlichkeit, mit der der 25-Jährige diese Taten geschildert hat, abgestoßen, aber auch neugierig gemacht. Diese Gleichgültigkeit hat in mir die Frage provoziert: Was sind das für Menschen, die solche Verbrechen begehen?
Und wer sind diese Menschen?
Ich definiere jemanden als Serientäter, der zu unterschiedlichen Zeiten wenigstens zwei Tötungsdelikte begangen hat und schuldfähig ist. Der typische deutsche Serienmörder ist männlich und zwischen 20 und 40 Jahren alt, ledig, durchschnittlich intelligent, hat keine Arbeit oder geht einer unterprivilegierten Tätigkeit nach; vielfach sind es Einzelgänger.
Sie haben 674 Serienmorde untersucht, mit Tätern und vielen Opfern, die Mordversuche überlebt haben, gesprochen. Was ist die Haupterkenntnis Ihres Buches?
Es gibt viele Möglichkeiten, die lebensbedrohliche Begegnung mit einem Serienmörder zu vermeiden. Kommt es dann doch dazu, ist man einem solchen Täter aber keineswegs hilflos ausgeliefert. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass auch diese Täter, denen man ein hohes Maß an Kaltblütigkeit und Erbarmungslosigkeit unterstellt, in jeder Phase eines Verbrechens nicht nur ansprechbar, sondern auch steuerbar sind. Und über diese Möglichkeiten soll mein Buch aufklären.
Stephan Harbort
Stephan Harbort ist Kriminalhauptkommissar in Düsseldorf. Er ist Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Düsseldorf und Referent am Polizeifortbildungsinstitut Neuss. Er entwickelte mit Universitäten Fahndungsmethoden zur Überführung von Serientäter und ist Verfasser zahlreicher Fachaufsätze zu Kriminalistik, Kriminologie und Krimi-Psychologie.
Ein potentielles Opfer kann sich also retten?
Ja, genau. Ein Serienmörder benötigt nämlich durchschnittlich 31 Versuche, um eine Tat vollbringen zu können - die meisten Menschen, die einem solchen Täter nahe kommen, überleben also. Ein Beispiel: Eine Frau, mit der ich gesprochen habe, stieg als Anhalterin zu einem Mann ins Auto, der Jahre später als Serienmörder überführt werden sollte. Sie hat relativ schnell ein ungutes Gefühl bekommen und beschlossen, sich aus dieser Lage zu befreien. Als sie an einer Ampel neben einer Bushaltestelle zu stehen kamen, tat die Frau intuitiv genau das richtige. Geistesgegenwärtig rief sie einer ihr unbekannten älteren Dame zu: "Hallo Tante Marie, wie geht es dir?" Der Mann hat sofort angehalten und die damals 13-Jährige aussteigen lassen.
Muss jeder, der nicht ständig auf der Hut ist, Angst haben, Opfer eines Serienmörders zu werden?
Nein, natürlich nicht. Zum Glück gibt es nur wenige Täter, und die Gefahr, Opfer eines Serienmörders zu werden, ist gering. Aber die Gefahrensituationen sind weiter verbreitet, als wir bisher dachten. Und es muss ja nicht gleich ein Serienmörder sein, der uns in Gefahr bringt oder Böses will. Insofern steht der Serientäter stellvertretend für viele andere Verbrechertypen, die ähnliche Strategien anwenden, um an Opfer zu gelangen.
Warum hält man Serienmörder für besonders erfolgreiche Verbrecher?
Weil in den Medien lediglich über die Taten berichtet wird, die auch vor Gericht verhandelt werden, also die vollbrachten oder versuchten Tötungen. Aber die übrigen Anbahnungsversuche, wo die Täter ebenfalls mit Tötungsvorsatz gehandelt haben, es aber nicht zur Tat gekommen ist, bleiben unberücksichtigt. Und das ist das Spannende an diesem Thema: Warum ist es in diesen Fällen nicht auch zu einer Tat gekommen?
Begegnung mit dem Serienmörder
Für sein aktuelles Buch "Begegnung mit dem Serienmörder" (Erscheinungstermin: 18.August, Droste Verlag) führte Stephan Harbort die erste Studie zu deutschen Serienmord-Opfern durch. Hierfür untersuchte Harbort 674 Einzeltaten in den Jahren 1945 bis 2007. Er sprach mit Tätern und mit Menschen, die den Serienmördern entkommen sind. Ergänzt wird das Buch durch statistisches Material.
Und Ihre Antwort darauf?
Die Täter sind keineswegs so gerissen und professionell, wie oft angenommen wird. Sie können von ihrem Tötungsvorhaben abgebracht werden. Das Verhalten des Opfers spielt eine große Rolle. Es gibt keine goldenen Verhaltensregeln, aber einige Empfehlungen darf ich jedem geben, der in eine brenzlige Situation gerät: Zunächst sollte man sich ein Bild von dem Menschen machen, der einen bedroht. Dann würde ich probieren, eine emotionale Beziehung zu diesem Menschen aufzubauen. Denn viele Täter sehen in ihrem Opfer keinen Menschen, sondern ein Objekt, ein Ding. Es geht dabei um Entrechtung und Entmenschlichung…
…Man muss also einen Menschen aus sich machen?
Genau. Das klingt zwar paradox, macht aber Sinn.
Wie werde ich denn vom Objekt zum Mensch?
Viel sprechen ist wichtig, den Täter beschäftigen. Ein gutes Beispiel: Ein Serienmörder hat drei Anhalterinnen mitgenommen und getötet. Im Prozess gegen den Mann sind viele Frauen als Zeuginnen aufgetreten, die ebenfalls mit ihm gefahren sind, aber verschont wurden. Warum? Weil sie ihn regelrecht vollgequatscht, sich aus der Anonymität gelöst haben. Er hat nicht einmal den Versuch gemacht, sie in seine Gewalt zu bringen. Die getöteten Opfer hingegen waren zurückhaltend. In diesen Fällen konnten sich beim Täter seine sadistischen Phantasien aufbauen und er sich langsam in die Rolle des Täters hineinfinden.
Es geht in Ihren Schilderungen oft um weibliche Opfer.
Das stimmt, Frauen werden öfter angegriffen. Das typische Opfer eines Serienmörders ist weiblich, ledig, kommt aus der sozialen Unter- oder Mittelschicht und geht einer unterprivilegierten beruflichen Tätigkeit nach. Allerdings wäre es grundfalsch, den genannten Personenkreis als besonders gefährdet zu bezeichnen.
Spielt der sexuelle Aspekt häufig eine Rolle bei Serienmorden?
Nein. Nur bei zwanzig Prozent der Fälle sind sexuelle Motive der Hintergrund. Der Anteil von Tätern, die ihr Opfer vergewaltigen und dann zur Verdeckung ermorden, ist noch geringer. In den meisten Fällen werden sexuelle Handlungen instrumentalisiert.
Was heißt das?
Oft ist der Täter nicht sexuell erregt, sondern benutzt sexuelle Handlungen, um dem Opfer eindeutig seine Macht zu demonstrieren.
Wenn Sex kein häufiges Motiv ist: Was ist es dann? Ist bei den Serienmördern der Mord an sich das Motiv?
Nein. Die meisten Taten passieren aus eher pragmatischen Gründen: Entweder wird das Opfer getötet, um die Tat, beispielsweise eine Vergewaltigung oder einen Raub, überhaupt begehen zu können. Oder das Opfer soll als Zeuge für immer mundtot gemacht werden. An dritter Stelle folgt das Motiv Habgier.
Wie unterscheidet sich ein Serienmörder vom „normalen“ Einmalmörder? Oder anders gefragt: Wie wird ein Einzeltäter zum Serientäter?
Dafür müssen wir uns von Tätern und Taten ein wenig lösen und ein Tötungsdelikt als Problemlösungsversuch betrachten…
Der Mord löst ein Problem?
Ja, genauso ist es. Der Standardfall ist die Tötung des Intimpartners, etwa wenn der Mann seine Frau erwürgt, weil sie sich von ihm trennen will. Für diesen Täter ist die Frau das Problem. Mit der Tat entfällt auch das Problem, und es besteht für den Täter kein weiterer Anreiz, zu töten. Viele Einmalmörder werden nie wieder zum Täter. Bei Serienmördern hingegen stellt meistens nicht das Opfer das Problem dar, sondern die Persönlichkeitsstörung des Täters wirkt motivierend. Das Opfer ist also nur Mittel zum Zweck, um abnorme Bedürfnisse zu befriedigen. Aber auch wenn eine solche Tat gelingt, bleibt die psychische Abnormität des Mörders unbehandelt – die zwangsläufige Folge sind neue Tatanreize und Taten.
Serienmörder sind also Psychopathen?
Bei 85 Prozent dieser Menschen liegen gravierende Persönlichkeitsauffälligkeiten vor. Die Täter sind allerdings nicht geisteskrank im Sinne klinischer Diagnostik. In der Regel werden sie nicht verhaltensauffällig.
Aber Serienmörder müssen auch ziemlich gut sein in dem, was sie tun, da ihnen mehrere Morde "gelingen"?
Ein weit verbreiteter Irrtum. Die allermeisten dieser Menschen haben keinen ausgefeilten Plan. Ihr Opferprofil ist eher schematisch und unscharf. Es werden bestimmte Regionen angesteuert, um dort auf ein Opfer zu treffen. Was den Tätern zugute kommt, sind die Umstände.
Wie meinen Sie das?
Bei der gewöhnlichen Einmaltat gibt es wie gesagt meistens eine enge Beziehung zwischen Täter und Opfer. Das macht es leicht, mögliche Täter zu identifizieren. Bei Serienmorden hingegen fehlt in etwa 80 Prozent der Fälle eine solche Beziehung. Die Polizei sucht also nach dem großen Unbekannten.
Sind darunter auch Frauen? Also: Wie hoch ist der Frauenanteil unter den Serienmördern?
Vor rund zehn Jahren waren es noch zwischen 15 und 20 Prozent, jetzt sind es rund 25 Prozent.
Wie erklärt sich dieser Anstieg?
Gerade in den letzten zehn Jahren sind vermehrt serielle Patiententötungen in Pflegeheimen und Krankenhäusern aufgedeckt worden. Bei diesen Taten ist der Frauenanteil besonders hoch: etwa 50 Prozent. Hinzu kommen jetzt gehäuft Frauen, die ihre Neugeborenen töten.
Sie haben es mit Mördern zu tun, die furchtbare Verbrechen begangen haben. Wie sind die Gespräche mit diesen Menschen?
Es sind keine Monster. Diese Menschen haben auch ihre positive Seiten, die aber verschüttet sind. Trotzdem waren die Unterhaltungen teilweise sehr unangenehm. Etwa, als ein Frauenmörder sich produzieren wollte. Er kokettierte mit seiner Bestialität und sprang immer wieder auf, um mir voller Stolz zu erzählen, wie er einer Frau die Kehle durchgeschnitten hat.
Welcher Täter hat am meisten Eindruck auf Sie gemacht?
Das war ein junger Mann, der zwei ältere Damen äußerst kaltblütig getötet hat. Aber beeindruckt hat mich weniger, was er getan hat, sondern viel mehr, was er nicht getan hat. Dieser Mann hat üblicherweise älteren Frauen aufgelauert, sie ausbaldowert und ist dann in ihre Wohnungen eingedrungen. Er hatte sich dann ein weiteres Opfer ausgesucht. Er ist dieser Frau und ihrer Tochter mit der Absicht gefolgt, beide zu töten. Er saß dann vor deren Wohnung und wartete auf seine Gelegenheit. Entweder die Frau oder das Kind haben in diesem Augenblick angefangen, Klavier zu spielen. Diese Musik hat den Mann so beeindruckt, dass er sein Vorhaben nicht umsetzen konnte. Er sagte mir: Diese Musik war so schön, sie hat mich an bestimmte Dinge in meiner Kindheit erinnert, dass ich diese Menschen nicht töten konnte. Er sei dann einfach gegangen. Dieses Bild hat sich mir förmlich eingebrannt: Da sitzt jemand am Klavier und spielt fröhlich um sein Leben, ohne auch nur zu ahnen, dass ihn ein anderes Lied vielleicht das Leben gekostet hätte.