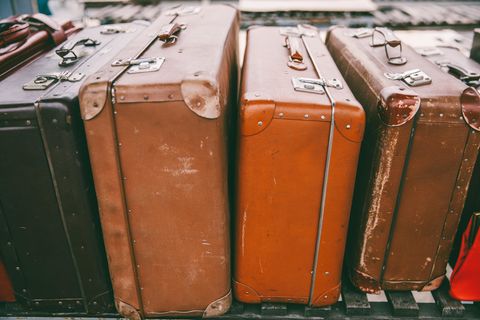Es geht um Eifersucht, Mord und Kannibalismus. Einer der bizarrsten Kriminalfälle in der Geschichte der rheinland-pfälzischen Justiz wird seit Donnerstag erneut vor dem Landgericht Koblenz verhandelt. Angeklagt ist ein 26-jähriger Elektriker, der im Verdacht steht, seine Kusine erstickt, die Leiche anschließend zerstückelt, Teile davon in einem Backofen erhitzt und aufgegessen zu haben. Wegen einer Gesetzeslücke hat der Angeklagte seinen Freispruch dennoch sicher. Die Anwältin des Mannes kündigte zu Beginn des zweiten Prozesses am Donnerstag ohnehin an, ihr Mandant werde sich nicht zu den Vorwürfen äußern.
Was genau am 10. Januar 2002 in Brohl-Lützing (Kreis Ahrweiler) geschah, ist bis heute nicht restlos geklärt. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen soll der Angeklagte Thomas S. das Opfer im Schlaf erwürgt haben. In einem erstinstanzlichen Urteil vom 1. Dezember 2003 kam das Koblenzer Gericht zu dem Ergebnis, dass der Beschuldigte die Leiche an einem unbekannten Ort zerlegte, die Teile anschließend in seiner Wohnung lagerte und einige auch in seinem Backofen erhitzte. Ein Rechtsmediziner hatte zudem festgestellt, dass Reis an manchen Leichenteilen haftete.
Wesentliche Leichenteile vermisst
Ob der Elektriker seine Kusine teilweise aufgegessen hat, ist noch nicht bewiesen. Wesentliche Teile der Leiche - die Brüste und die Geschlechtsteile - wurden nie gefunden, wie auch der Bundesgerichtshof feststellte. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft trieb Eifersucht den heute 26-Jährigen zu dieser grausigen Tat: "Der Tatverdächtige hat selbst angegeben, die 22-Jährige habe ihm einige Tage vor der Tat mitgeteilt, sie sei möglicherweise von einem anderen schwanger", erklärte die Anklagebehörde. Vetter und Kusine lebten bis zu dem Verbrechen gemeinsam in einer Wohnung, die ihrer Großmutter gehörte.
Geradezu unbeteiligt berichtete er nach Aussage eines Polizisten im Januar 2002, er habe morgens nach dem Aufwachen den Kopf und das Becken seiner Cousine in der Badewanne gefunden. Der Brustkorb habe im Backofen gesteckt. "Er war absolut emotionslos", sagte der Polizeibeamte über die erste Vernehmung des Tatverdächtigen. Das sind die einzigen Angaben, die der arbeitslose Elektriker jemals zur Sache gemacht hat.
Was den Fall aus der Masse der Mordverfahren heraus hebt, ist jedoch nicht allein die besondere Grausamkeit. Es ist mehr noch eine juristische Merkwürdigkeit, die von vornherein ausschließt, dass das Landgericht Koblenz den 26-Jährigen zu einer Haftstrafe verurteilt.
Die Koblenzer Richter waren im Dezember 2003 zu dem Ergebnis gelangt, der Angeklagte sei geisteskrank und seine Schuldunfähigkeit nicht auszuschließen. Daher sprachen sie den Mann frei und ordneten seine Einweisung in eine geschlossene Anstalt an. Gegen diese Entscheidung ging der 26-Jährige mit Erfolg in Revision. Im vergangenen November hob der Bundesgerichtshof das Urteil auf. Der Tatverdächtige blieb allerdings weiterhin in der Psychiatrie.
Bundesrichter monierten Gutachten
Die Karlsruher Bundesrichter monierten vor allem das psychologische Gutachten, auf das sich das Landgericht gestützt hatte. Die Einlassungen des Sachverständigen seien unklar und mit erheblichen Mängeln behaftet gewesen. Sollte der psychologische Sachverständige nun zum Ergebnis kommen, der Beschuldigte sei doch schuldfähig, wäre eine Verurteilung eigentlich zwingend.
Paragraf 358 der Strafprozessordnung legt allerdings fest, dass ein zweiter Prozess nicht zu einem schlechteren Urteil führen darf als der erste, wenn allein der Angeklagte in Revision gegangen ist. Dass ein Beschuldigter einmal gegen einen Freispruch Rechtsmittel einlegen könnte, hat der Gesetzgeber offenkundig nicht einkalkuliert.
"Hier wird eine Lücke im Bundesgesetz deutlich, die auszufüllen ist", betont der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin. Der FDP-Politiker verweist auf eine bereits im Sommer 2004 eingebrachte Bundesratsinitiative Bayerns und Sachsen-Anhalts, die vorsieht, gefährliche Täter ins Gefängnis zu schicken, wenn eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus scheitert. "Das Sicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit und das Rechtsempfinden der Bevölkerung wiegen in einem solchen Fall schwerer als die Belange des Angeklagten", betont Mertin.
Freispruch ohne Freilassung
Ein Täter wird der Tat überführt, kann aber nicht verurteilt werden und kommt auf freien Fuß - ein juristischer Albtraum nicht nur für Richter und Staatsanwälte. Dennoch sind Fachleute in der rheinland-pfälzischen Justiz davon überzeugt, dass es zu einer Freilassung nicht kommen wird. Sie verweisen auf die Möglichkeit, Personen, die eine Gefahr für sich und andere darstellen, nach dem rheinland-pfälzischen Landesgesetz für psychisch Kranke in eine Anstalt einweisen zu lassen.